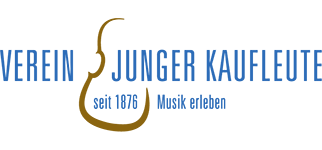Programm 2025/2026 – 7. Konzert
SO | 15.03.26 | 19.30 Uhr
Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker
Jedes Symphonie-Orchester hat zwar seine Cellogruppe, aber dass sich die tiefen, großen Streicher als eigenständige Formation, als Orchester im Orchester zusammengetan und von einem Erfolg zum andern gespielt haben, das gibt es weltweit nur dieses eine Mal. Deshalb weiß jeder Musikkenner, wohin die Zwölf Cellisten gehören, selbst wenn der Name ihres Orchesters nicht fällt.
Die Zwölf ist eine mythische Zahl, sie steht für Vollkommenheit. Zwölf Monate machen ein Jahr komplett und zwölf (Halb-)Töne eine Oktave, in zwei Mal zwölf Stunden haben Tag und Nacht je einmal ihre Runde gemacht. Zwölf Stämme bildeten das alte Volk Israel, zwölf Vertraute begleiteten den Gründer der hier landläufigen Religion und trugen seine Lehre durch die Lande, zwölf Tore führen in das himmlische Jerusalem.
Zwölf Cellisten beschäftigen die Berliner Philharmoniker, die bloße Tatsache aber wirft mancherlei praktische Schwierigkeiten auf. Sie fordert Findigkeit und Witz heraus. Denn wenn die Zwölf in eigener Sache unterwegs sind, kann der Rest des Orchesters einpacken, es sei denn, es wäre Blasmusik angesagt, was selten der Fall ist. Es gibt zwar symphonische Literatur ohne Geigen, aber (fast) keine ohne Celli.
Seit 1972 musizieren sie zusammen und treten als Ensemble auf, manchmal in Berlin, öfter auswärts, ganz oft in weiter Ferne.
Pablo Casals soll von einem Orchester geträumt haben, das nur aus Violoncelli besteht – eine ungewöhnliche Idee, aber auch wieder nicht ganz so neu. Sie beweist ein gutes historisches Gedächtnis. Denn zur Zeit der Musik, die man heute die “Alte” nennt, also vor drei- bis vierhundert Jahren, gab es sogenannte Gambenconsorts, kleine Ensembles, die nur mit den zarter klingenden Cousinen des Violoncellos besetzt wurden, den Viole da gamba, den Violen, die man zwischen den Beinen und nicht mit dem Arm hielt. Gut: Man baute diese Mehrsaiter mit dem leicht nasalen Klang und den Bünden am Griffbrett damals in verschiedenen Größen und in diversen Tonlagen. Ein Gambenconsort verfügte also über hohe und tiefe Stimmgruppen. Das unterscheidet sie von einem reinen Celloensemble. Doch die Klangfarbe war in ihrer Grundform ähnlich einheitlich.
Pablo Casals kannte sein Instrument und dessen Möglichkeiten genau, und er wusste wohl: Nur mit der tiefen Abteilung der Streicher würde sich ein monoinstrumentales Orchester erfolgreich verwirklichen lassen. Ernsthafte Konkurrenz ist nicht zu befürchten. Stellen Sie sich eine Bühne voller Violinisten vor, kein einziges anderes Instrument wäre dabei. Die Musiker könnten vieles bieten, ihre Geige könnte jubilieren und brillieren, sie könnten ihre Virtuosität bis in die höchsten Höhen an den Rand der Hörbarkeit führen oder sich zu zart gewobenen Klangteppichen beruhigen – sie könnten durch Zupfen, Schlagen, Klopfen, Dämpfen und Forcieren ihrem Teufelsgerät ein wahres Kaleidoskop an Klangbildern entlocken – irgendwann würde man bei diesem Treiben das Fundament vermissen, die musikalischen Tragkraft der Tiefe. Den aber könnten selbst die Bratschen nicht erfüllen – allenfalls die Kontrabässe noch, aber denen fehlte dann in der Höhe die nötige Durchsetzungskraft, das kleine Quentchen Schärfe, das die Celli immer noch besitzen, wenn sie sich in den Klangbezirken der Flöten und Geigen bewegen.
Für die Erdung des Kunstgenusses ist hauptsächlich das Violoncello zuständig, denn es steht sogar mit drei Beinen auf solidem Grund: mit einem eigenen und zwei menschlichen. Kein Zweifel: Es ist das eigentlich universale unter den Orchesterinstrumenten. Es ist in allen Bereichen des weiten Klang- und Hörspektrums von den sonoren Tiefen bis in die schrillen Höhen zu Hause. Seine Kantilenen zeichnen sich durch einen eigenen Reiz aus, wenn sie im großen Orchester ansetzen, wird man immer Zeuge eines besonderen Ereignisses. Im Drama einer musikalischen Partitur setzen die Celli nicht selten die Ausrufezeichen. Vom schönen Klang bis zum dumpfen Schlag, vom edlen Gesang bis zu irritierenden Geräuschnebeln ist alles möglich, und ein wohlgeformter Körper sorgt bei der Riesenvielfalt musikalischer Aktionen immer für gute Resonanz. Pablo Casals war sich über die verborgenen Talente des Violoncellos völlig im Klaren. Er förderte sie mit einer eigenen Komposition, sinnigerweise einem Tanzstück, einer “Sardana”, deren Heimat Katalanien ist. Er setzte sie für ein Cello-Orchester, das über mindestens 32 Leute verfügen muss. Das war 1927.
Sir Simon Rattle: „Es ist einfach großartig,
was die 12 Cellisten machen.”
Claudio Abbado: „In ihrer einmaligen
Besetzung habe ich sie immer bewundert”
Herbert von Karajan: „Diese 12 sind wirkliche
Virtuosen auf ihren Instrumenten.”
Besetzung:
Bruno Delepelaire
Ludwig Quandt
Olaf Maninger
Martin Löhr
Solène Kermarrec
Stephan Koncz
Martin Menking
David Riniker
Nikolaus Römisch
Uladzimir Sinkevich
Knut Weber
Moritz Huemer
Programmslider: Stephan Roehl
Foto: Peter Adamik